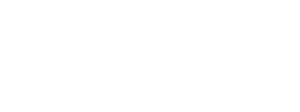Müssen wir die Wirtschaft schrumpfen, um das Klima zu retten?
Moderiert von der „Süddeutschen Zeitung“: Streitgespräch zwischen MCC-Direktor Ottmar Edenhofer und dem Vertreter der Postwachstumsökonomie Niko Paech.

MCC-Direktor Ottmar Edenhofer (links) beschäftigt sich mit CO2-Bepreisung. Niko Paech von der Universität Siegen plädiert für eine Gesellschaft, deren Bedürfnisse ohne Wachstum erfüllt werden. | Foto: MCC/Uni Siegen
Für manche ist es die Gretchenfrage der Klimapolitik: Sag, wie hältst du's mit dem Wirtschaftswachstum? Für die einen ist das ständige Streben nach Mehr der Quell allen Übels – schließlich führe doch erst der Überfluss den Planeten an seine Belastungsgrenzen. Andere meinen: Woher, wenn nicht aus einer dynamischen Wirtschaft, sollen die Ressourcen und die Innovationen für sozial verträglichen Klimaschutz kommen? Die „Süddeutsche Zeitung“ hat diese grundsätzliche Debatte jetzt journalistisch groß aufbereitet, in Form eines Streitgesprächs zweier prominenter Ökonomen. Es moderierten Michael Bauchmüller und Marlene Weiß. Veröffentlichung hier mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Herr Paech, Sie dürften zu den wenigen zählen, die den Corona-Einbruch der Wirtschaft begrüßen. Oder?
Niko Paech: Auch ein kompromissloser Wachstumskritiker würde einer Gesellschaft keine solche Rosskur zumuten wollen. Dafür bringt diese Krise zu viel soziales und gesellschaftliches Ungemach hervor. Natürlich befürworte ich einen Rückbau der Globalisierung, der Techniknutzung, der Industrieproduktion. Aber eben schrittweise – nicht durch diktatorische oder schicksalhafte Brechstangeneffekte. Ich schlage vor, im ersten Schritt eine 50-Prozent-Marke anzuvisieren, und dann zu prüfen, ob die Ökosphäre hinreichend entlastet wurde.
Herr Edenhofer, ist das ein Weg?
Ottmar Edenhofer: Ich kann nicht sehen, warum die Wirtschaftsleistung sinken muss, um die CO2-Emissionen abzusenken. Die Frage ist: Kann man das entkoppeln? Die Faktenlage ist eindeutig: Das Bruttoinlandsprodukt lag in der EU inflationsbereinigt im Jahr 2019 um 60 Prozent höher als im Jahr 1990, der Ausstoß von Treibhausgasen um 24 Prozent niedriger.
Paech: Diese Entkopplung ist nicht einmal theoretisch ohne logische Widersprüche erklärbar. In einem nahezu geschlossenen System wie der Erde gibt es materiell nichts zum Nulltarif. Eine Wertschöpfung, die kaum der Umwelt schadet, existierte vielleicht in spätromantischen, nicht wachsenden Handwerker- und Agrargesellschaften, aber nicht mehr, seit die industrielle Revolution menschliche durch maschinelle Arbeit ersetzte.
Sie wollen die Maschinen abschaffen?
Paech: Drehen Sie mir nicht das Wort im Mund herum! Nein, ich will nur ein Dilemma erklären: Eine „ökologische Produktion“, die allein auf menschlicher Arbeit beruht, die kaum maschinell verstärkt wird, erreicht schnell eine Grenze, sie kann nicht wachsen. Wachstum setzt erst mit der Technisierung ein, kann somit nie ökologisch unschädlich sein. Deshalb ist das Bruttoinlandsprodukt eine Maßgröße allenfalls für ökologische Zerstörung.
Edenhofer: Man kann durchaus fragen, ob das Bruttoinlandsprodukt das Maß aller Dinge ist. Aber empirisch ist der Befund: Länder mit einem größeren BIP haben auch höhere Lebenserwartungen, geringere Säuglingssterblichkeit, bessere Ausbildung, höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen und so weiter.
Gäbe es eine Alternative zum BIP?
Edenhofer: Wir brauchen da sicher noch ein besseres Maß, das Aspekte wie Lebenserwartung, Einkommensverteilung und Freizeit mit einbezieht. Dann liegt Europa kaum hinter den USA. Aber ich sehe keinen Grund, das Bruttoinlandsprodukt gezielt abzusenken. Diese Rückbau-Debatte erscheint mir obsessiv.
Paech: Ich sehe nicht, dass die Zunahme von Gesundheit, Lebenserwartung oder Bildung in direktem Zusammenhang zum Wachstum steht. Wie sollen Hochöfen, Flugreisen, Kreuzfahrten und noch mehr Wohnraum die Lebenserwartung erhöhen? Die Wirtschaft muss für eine gute medizinische Versorgung nicht wachsen. Wir sollten mal unterscheiden zwischen basalen Bedürfnissen und dekadentem Luxus, der ökologisch ruinös ist.
Und wer entscheidet, welche Bedürfnisse befriedigt werden?
Paech: Das geht nur im demokratischen Diskurs. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand verhungert, weil Goldringe, Kaviar, Flugreisen und SUVs teurer werden oder verschwinden. Im Gegenteil, das führt zu mehr sozialer Gleichheit. Aber wenn Politik und Wissenschaft nicht mal die Frage stellen, wo Reduktionspotenziale bestehen, dann gibt es in einer aufgeklärten Gesellschaft leider nicht viel Hoffnung.
Edenhofer: Ich sehe wenig Möglichkeiten, in freien Gesellschaften solche Unterscheidungen zu treffen. Es mag ja sein, dass noch keiner am Mangel an Champagner gestorben ist. Aber was ist mit Bildung und Gesundheit? Das sind sehr teure Güter – und je reicher die Leute werden,
„Ökologische Schäden sind kein Beweis dafür, dass Wirtschaftswachstum generell schlecht ist.“
desto stärker wachsen ihre Bedürfnisse danach. Die Vorstellung, hier im demokratischen Diskurs zwischen Grund- und Luxusbedürfnissen zu unterscheiden und letzteren die Berechtigung abzusprechen, erscheint mir abwegig. Übrigens müssten wir auch mal darüber reden, was „Güter“ eigentlich sind. Da scheint mir Herr Paech eine sehr dingliche Vorstellung zu haben.
Das müssen Sie erklären.
Edenhofer: Wenn Sie mir Saxophon beibringen, Herr Paech, und ich Ihnen dafür moderne Wohlfahrtsökonomie, dann sind das Güter. Dass Wertschöpfung sich nur auf das bezieht, was wehtut, wenn man dagegen stößt, das ist Unsinn! Bildung, Gesundheit, Pflege – in vielen Bereichen gibt es Güter, die im Laufe der Zeit auch noch an Qualität zunehmen, sodass das Bruttoinlandsprodukt zunimmt.
Paech: Dienstleistungen können größere ökologische Rucksäcke haben als die guten alten physischen Produkte. Wenn jemand als Masseur tätig ist, aber so viel Geld verdient, wie er vorher am Hochofen bekommen hat, dann verlagern wir nur die Stahlproduktion nach China und der Masseur fragt dieselben Güter nach. Eine ökologische Entlastung folgt daraus nicht.
Edenhofer: Ökologische Schäden sind kein Beweis dafür, dass Wirtschaftswachstum generell schlecht ist. Es liegt dann daran, dass wir insgesamt noch zu wenig Anreize setzen, Emissionen und Wertschöpfung zu entkoppeln.
Wie könnten solche Anreize aussehen?
Edenhofer: Wir kennen ja die planetare Belastungsgrenze. Letztlich müssen wir die CO2-Emissionen schrittweise auf null herunterfahren, indem wir ihnen einen über die Zeit steigenden Preis geben. Wir werden ja sehen, ob dann noch Wachstum gelingt. Ich bin weder Wachstumsgegner noch Wachstumsfetischist, ich bin da agnostisch. Aber man muss dort ansetzen, wo Wirtschaftsleistung Schäden verursacht, und diese Schäden zurückführen. Klimaschutz über Preise hat einen großen Vorteil: Ich muss nicht unterscheiden zwischen Luxus- und Grundbedürfnissen. Das hat mehr Chancen auf gesellschaftliche Zustimmung. Allerdings müssen die einkommensschwächeren Haushalte kompensiert werden, es geht nicht ohne soziale Gerechtigkeit.
Paech: Da rennen Sie in eine Falle. Klimaschutz scheitert trotz solcher Kompensationsversprechen daran, dass sofort die Einkommensschwächsten als negativ Betroffene vorgeschoben werden. Gerade CDU und SPD nutzen dieses Argument.
Edenhofer: Wir haben in Modellen gezeigt, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung so zurückgegeben werden können, dass einkommensschwache Haushalte unterm Strich sogar bessergestellt werden. Ich hoffe natürlich, dass die Maßnahme Innovationen auslöst, sodass die CO2-Preise nicht ganz so stark ansteigen. Aber sie werden in eine Größenordnung kommen, die ohne soziale Flankierung nicht durchsetzbar wäre.
Paech: So macht sich der Staat abhängig davon, dass genug Einnahmen aus Umweltverbräuchen entstehen, um diese Flankierung zu finanzieren. Und würden die CO2-Preise komplett kompensiert, würden einkommensschwache Schichten ihr Verhalten kaum ändern, während Menschen mit hohen Einkommen sich ihren Lebensstil ohnehin weiter leisten können – und das mit symbolischer Kompensation: Ich habe den ökologischen Preis bezahlt, also kann ich den nächsten Flug nach Honolulu buchen und bin mit mir im Reinen. Um das zu verhindern, bräuchten wir eine CO2-Steuer von 200 oder 300 Euro pro Tonne – statt der homöopathischen Dosen bisher. Wie Sie das politisch umsetzen und obendrein sozialpolitisch kompensieren wollen, bleibt Ihr Geheimnis.
Edenhofer: Dass Rückverteilung die ökologische Wirkung zunichte macht, stimmt einfach nicht. Die Kompensation bekommen die Haushalte ja unabhängig von ihren Emissionen, und wer Emissionen vermindert, stellt sich besser. Nach unseren Berechnungen sollten die CO2-Preise in Europa, wenn wir die angekündigten Klimaziele umsetzen wollen, bis 2030 auf 100 Euro steigen, besser noch 150 Euro. Das wird zwar nicht einfach. Es ist aber immer noch sehr viel einfacher, transparente CO2-Preise einzuführen, als gemäß Ihrem Konzept eine Monsterrezession einzuleiten, die alle schlechterstellt und nicht nur jene, die Schäden verursachen.
Paech: Bis heute existiert kein einziges Land, in dem eine demokratische Mehrheit für eine konsequente Preissteuerung zustande kam. Auch die Ökosteuer von Rot-Grün war nur Homöopathie. Und eins noch: Gerade untere Einkommensschichten präferieren oft Handlungen, die besonders CO2-intensiv sind, um sich kulturell anzupassen. Eine emanzipierte Gesellschaft kann ihre Mitverantwortung nicht an die Politik delegieren. Sie muss eigenständig Lebensstile hervorbringen, die zukunftsfähig und somit kopierfähig sind. Erst dieses Signal setzt gesellschaftliche und politische Veränderung in Gang.
Was sagen Sie Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern? Wollen Sie denen erklären, dass aus dem erhofften bescheidenen Wohlstand leider nichts wird?
Paech: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Wir können doch Menschen in Afrika nicht allen Ernstes raten, unsere Fehler zu wiederholen! Dann könnten wir gleich einen interplanetarischen Grabstein in Auftrag geben. Es bedarf eines internationalen Konsenses über einen bescheidenen Wohlstand, der einhergeht mit im Schnitt einer Tonne CO2-Äquivalenten pro Person und Jahr. Etablieren müssten wir den zuallererst in Europa, um den Menschen im globalen Süden ohne die bisherige Arroganz zu zeigen: Wir sind uns nicht zu schade, eine global gerechte Lebensführung umzusetzen. Denn an unserem Beispiel orientiert sich der globale Süden.
„Der Handlungsdruck ist groß. Aber gerade deshalb bleibt für Utopien nicht die Zeit.“
Edenhofer: Im Vorfeld des Weltklimaabkommens von Paris habe ich mit Vertretern aus fast 200 Staaten IPCC-Berichte verhandelt, und ich kann Ihnen sagen: Wenn Sie auf internationaler Ebene Klimaschutz mit Wachstumsstopp verbinden, ist das Gespräch sofort beendet. Das empfinden viele als Kolonialismus. Es geht darum, Klimaschutz und Entwicklung zu verbinden. Und als Erstes darum, dass in Südostasien der Kohleausstieg gelingt. Vietnam zum Beispiel hat jetzt ein Kohlemoratorium angekündigt, daraus lässt sich mit geschickten Anreizen ein Kohleausstieg machen. Wenn wir dort zinsvergünstigte Kredite anbieten und sie dazu bewegen, dass sie Emissionshandel oder CO2-Preise einführen, das wäre aus meiner Sicht ein richtiger, pragmatischer Schritt. In dieser Dekade entscheidet sich, ob wir die Tür für das 1,5-Grad-Ziel offen halten. Wir haben nicht die Zeit für illusionäre Spielereien.
Aber beruht nicht ein großer Teil des asiatischen Wachstums auf Produkten für uns? Kann das nachhaltig sein?
Edenhofer: In der gegenwärtigen Form ist das nicht nachhaltig. In der Tat ist Europa nicht nur Netto-Importeur von Gütern aus der Region, sondern auch von Emissionen. Wird das in den Handelsströmen realistisch berücksichtigt, dann liegen die Emissionen der EU um sieben Prozent höher – was aber an der Entkopplung von Wachstum und Emissionen nichts grundlegend ändert. Wegen der globalen Verflechtung ist es wichtig, dass wir uns schrittweise und durch freiwillige Zustimmung der Länder auf eine internationale CO2-Bepreisung hinbewegen. Dann passen sich die Handelsströme entsprechend an. Der Handlungsdruck ist groß. Aber gerade deshalb bleibt für Utopien, wie sie Herr Paech vorstellt, nicht die Zeit.
Paech: Für mich ist Ihre technizistische und institutionelle Zuversicht eine reine Utopie. Wir proklamieren seit Jahrzehnten technische und politische Lösungen, haben aber nur ständig neue Nachhaltigkeitsprobleme aufgetürmt. In der Postwachstumsökonomie, wie ich sie vorschlage, ist nichts utopisch. Statt technische Abenteuer einzugehen, würden längst erprobte und bewährte Praktiken reaktiviert: Denken wir an Sharing, Reparatur, Handwerk, Regionalökonomie, ökologischen Landbau. Das soll utopisch sein? Und zum Zeitproblem: Es ist genau umgekehrt. Nichts geht schneller, als sich daran zu orientieren, dass Klimaschutz eine Kunst der Unterlassung und nicht des zusätzlichen Bewirkens ist. Nichts kostet weniger und ist technisch und politisch voraussetzungsloser.
Warum ist es noch nicht passiert, wenn es so einfach ist?
Paech: Das hat viele Gründe. Dazu zählt insbesondere die wissenschaftlich befeuerte Technikgläubigkeit, die ein bequemes Alibi für die Beibehaltung ruinöser Lebensstile liefert. Und wenn Herr Edenhofer sagt, wir könnten eine Wende zum Weniger nicht wollen, weil sie politisch nicht durchsetzbar sei, wird das zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn alle Politiker, Wissenschaftler und Medien beschwören, nein, das geht nicht, dann genau geht es nicht. Wir sollten hier ehrlicher sein. Kohle zum Beispiel durch Erneuerbare zu ersetzen, scheitert an technischen Grenzen oder gelingt nur zum Preis anderer ökologischer Schäden. Bleibt nur der dritte Weg jenseits von bisherigem und grünem Wachstum: Wir müssen ersatzlos runter mit dem Energieverbrauch – und das setzt materiell genügsamere Ansprüche voraus.
Edenhofer: Dass Energieerzeugung aus Sonne und Wind die ökologischen Lebensgrundlagen genauso belastet wie Energieerzeugung aus Kohle, ist eine falsche Behauptung. Aber natürlich haben auch Erneuerbare ihren Preis, deshalb sind Effizienzsteigerungen beim Strom- und generell Energieverbrauch notwendig. Was mich stört, ist, dass Sie behaupten, dass diese Verbräuche in direkter Beziehung zum Bruttosozialprodukt stehen. Das halte ich für den blinden Fleck in Ihrer Argumentation.
Effizienzfortschritte gibt es ja schon. Autos sind heute viel sparsamer. Dafür werden Motoren größer, und es fahren mehr herum. Fressen solche Rebound-Effekte nicht allen Fortschritt auf?
Edenhofer: In der Tat lagen die CO2-Emissionen im deutschen Straßenverkehr im Vor-Corona-Jahr 2019 um vier Prozent höher als 1990. Bei sparsamen Motoren sinkt der Benzinverbrauch pro gefahrenem Kilometer. Dass die Leute dann mehr fahren, zeigt doch, dass sie auf Anreize reagieren. Darum sage ich: Wir brauchen auch im Verkehrssektor über die Zeit steigende CO2-Preise, eben damit wegen der Effizienzgewinne nicht mehr gefahren wird. Sie müssen eine dominante Rolle spielen.
Paech: Das reicht nicht! Verantwortbar im Sinne des Zwei-Grad-Klimaziels kann nur eine Lebensstilpolitik sein, die an der regulativen Idee ansetzt, dass jedem Menschen nur ein gewisses Budget an ökologischer Inanspruchnahme zustehen kann. Das sollte im Schulunterricht, und erst recht in Politik und Wissenschaft zum Maßstab werden. So etwas muss vorgelebt werden.
Edenhofer: Wenn wir das Zwei-Grad-Ziel erreichen wollen, brauchen wir eine jährliche Senkung der Kohlenstoffintensität von etwa fünf Prozent – beim 1,5-Grad Ziel sind es sogar sieben Prozent. Es gibt Menschen, die freiwillig auf Konsum verzichten, das ist okay. Dass wir generell Lebensstiländerungen benötigen – klar. Aber selbst wenn dadurch unser Bruttoinlandsprodukt über lange Zeit um zwei Prozent im Jahr sinken würde, was in der Wirtschaftsgeschichte ohne Beispiel wäre, dann blieben immer noch drei bis fünf Prozent notwendiger Schrumpfung der Emissionen pro Jahr, die die Politik auf andere Weise erzwingen müsste. Ich finde es falsch und auch verantwortungslos, Klimaschutz hauptsächlich von der Verzichtsseite her anzugehen.
Paech: Wenn Sie sagen, Nullwachstum reicht nicht, also brauchen wir Technik, kann ich Ihnen nicht folgen. Gerade weil Nullwachstum nicht reicht und die Technik versagt, bedarf es eines schrittweisen und sozialverträglichen Rückbaus bis auf ein überlebensfähiges Niveau. Der Homo sapiens ist als soziales Wesen genau dann zur tiefgreifenden Veränderung fähig, wenn er reale Beispiele dafür vorfindet, an denen er sich orientieren kann.
Aber wenn sich das Klima stabilisieren soll, müssen wir klimaneutral werden. Wie soll denn das ohne moderne Technologien gehen?
Paech: Dass es nicht ohne Technologie geht, ist trivial. Aber sie löst kein Wachstumsproblem, weil sie nicht ohne ökologische Schäden zu haben, folglich zu dosieren ist. Um erneuerbare Energieträger, die im Übrigen maßlos überschätzt werden, so zu nutzen, dass wir damit nicht den letzten Rest an Natur zerstören, müssen wir ihren begrenzten Möglichkeiten durch eine hinreichend energiesparende Lebensweise entgegenkommen. Zwar könnten noch Autos genutzt werden, aber in weitaus geringerem Maß. Dafür werden wir viel mehr Fahrrad fahren. Wir werden auch das Internet nicht abschaffen müssen, aber nicht alle fünf Jahre unsere Hardware austauschen oder den ganzen Tag online sein.
Wachstum macht das große Versprechen, dass alle gleichzeitig mehr Wohlstand erreichen können. Wenn man das aufgibt, muss man den Reichen erst wegnehmen, was man den Armen geben will – Stoff für heftige Konflikte.
Paech: Schon möglich, aber kann jemand wollen, dass wir aus Angst vor Verteilungskonflikten unsere Lebensgrundlagen ruinieren? Das Unsozialste, wovon ich je gehört habe, ist die Zerstörung eines Planeten. Wenn ein Rest an Hoffnung auf Humanität und Aufgeklärtheit besteht, dann darauf basierend, dass die Wachstumskrise als Chance begriffen wird, über die Begrenzung und Umverteilung der Inanspruchnahme ökologischer Ressourcen mehr soziale Gerechtigkeit zu erlangen. Davon profitieren die Ärmsten, und für die Reichsten ist es kein Verzicht, sondern eine Befreiung vom Überfluss.
„Jeder Wandel, der unter freiheitlichen Bedingungen stattfand, hatte seinen Ursprung in Nischen.“
Edenhofer: Es ist ja unbestritten, dass etwa Europa oder die USA pro Kopf mehr Treibhausgas emittieren und reicher sind als andere Regionen. Aber wenn das globale Pro-Kopf-Einkommen nicht mehr weiter steigen und gleich verteilt sein soll, dann würde das bedeuten: Der Lebensstandard in den USA müsste um rund 80 Prozent abgesenkt werden. Ich halte es für völlig undenkbar, und auch für falsch, das überhaupt nur zu versuchen. Denn die Welt muss ja runter auf Netto-Null-Emissionen – das geht nur durch Innovation und Investitionen, nicht durch generellen Wachstumsverzicht.
Herr Paech, Sie reden viel von „wir“. Ist das der Teil der Gesellschaft, der bereit zu solchen Veränderungen ist? Wie wollen Sie verhindern, dass diese Menschen für die Trittbrettfahrer die Klimalast schultern?
Paech: Dieses Risiko ist in einer Demokratie nicht zu vermeiden. Ansonsten drängt sich die Gegenfrage auf: Wie wollen Sie Mehrheiten für das organisieren, was Herr Edenhofer vorschlägt? Jeder Wandel, der unter freiheitlichen Bedingungen stattfand, hatte seinen Ursprung in Nischen, in Reallaboren, bei Avantgardisten. Erst wenn neue Daseinsformen und Versorgungsmuster sichtbar werden, können sich die neuen Praktiken ausbreiten. Nur dann, niemals vorher, bringt die Politik den Mut auf, diese Entwicklung aufzugreifen. Dieser Prozess kann überall im Kleinen beginnen, und das ist bereits beobachtbar. Während der Wandel, den Herr Edenhofer anspricht, seit 50 Jahren erfolglos ist, weil er ein politisches Wunder benötigt.
Aber es gab ja schon wissenschaftliche Reallabore, etwa das „KLIB“ in Berlin, in dem Familien versucht haben, ihre Emissionen zu senken. Der Erfolg war ernüchternd, der Ausstoß ging kaum zurück.
Paech: Ich kenne dieses Experiment, halte es aber für wenig aussagekräftig. Wenn wir Europa als Ganzes betrachten, lassen sich immer mehr Reallabore und Beispiele für postwachstumstaugliche Lebensmodelle und Wirtschaftsformen finden. Etwa im Ernährungsbereich, mit „solidarischer Landwirtschaft“, Gemeinschaftsgärten, Food-Sharing. Die Leute warten nicht mehr auf einen politischen Godot – sie packen selber an.
Edenhofer: Sie glauben, dass die Menschen im Grunde nur auf materiellen Reichtum aus sind – und dass sie erst ihre Konsumabhängigkeit überwinden müssen, damit sie sich auf den Wandel zu Nachhaltigkeit einlassen. Ich habe ein anderes Menschenbild. Die Menschen verstehen wohl, dass wir Treibhausgas-Emissionen reduzieren müssen. Aber das ist für den Einzelnen nur sehr schwer möglich. Die Politik muss ihm dazu die Anreize geben. Nicht um ihm andere Bedürfnisse einzureden, sondern um ihm Entscheidungen zu erleichtern, auch mit Blick auf das Verhalten der anderen. Und dafür sind Preise sinnvoll. Sie liegen doppelt falsch: Sie stellen Forderungen an reiche Gesellschaften, die sie niemals erfüllen werden, und Sie verlagern zu viel Verantwortung auf den Einzelnen.
Haben Sie beide manchmal Angst, dass Sie falschliegen? Dass Ihre Ideen letztlich nicht aufgehen?
Edenhofer: Dass ich mich irren kann, davon gehe ich ständig aus. Gelingt es uns erstmals in der Menschheitsgeschichte, uns selber Grenzen zu setzen, um unser Überleben zu sichern? Das Weltklimaabkommen von Paris vor gut fünf Jahren war ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Seitdem gibt es Bewegung, auch außerhalb von Europa. Deshalb ist mir, trotz allem, um die Zukunft nicht bang.
Und Sie, Herr Paech? Befürchten Sie manchmal, dass Ihr Modell nicht rechtzeitig kommt?
Paech: Ich habe keine Angst, weil ich 60 Jahre alt bin und die möglichen Krisen für mich kaum mehr relevant sind. Aber ich sorge mich um nachkommende Generationen. Ansonsten gleicht die Wachstumsfrage ohnehin einer Gespensterdebatte. Es besteht bestenfalls noch die Wahl zwischen einem chaotischen oder freiwillig geordneten Rückzug aus dem ökosuizidalen Überfluss. Entweder wir ändern uns, oder wir werden geändert.